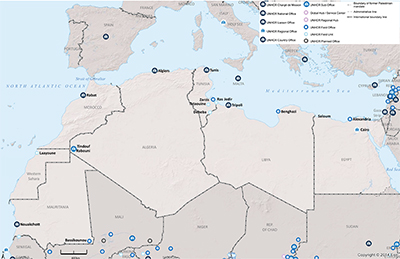Staunend beobachteten westliche Militärexperten, wie Russland binnen weniger Tage eine grosse Militärbastion in Syrien schuf. Mit dem Aufbau fern des Mutterlandes vollbrachten die Russen nach Meinung von Fachleuten eine logistische Meisterleistung, Ebenso staunenswert schnell errangen russische Jets neuester Machart die Lufthoheit über Westsyrien und flogen nach kurzer Zeit mehr Angriffe pro Tag als die westliche Allianz im Monat. Vom Kaspischen Meer sandte Russland neuartige Marschflugkörper in Richtung Syrien, die ihre amerikanischen Pendants an Reichweite übertreffen. Vor der Weltöffentlichkeit demonstriert sich Russland als militärische Supermacht. Vor allem zeigt sein Engagement in Syrien, dass es gründlich geplant und auf Dauer angelegt ist.
Wovon die Zaren träumten, wonach die Sowjetunion vergeblich strebte, hat Wladimir W. Putin erreicht: er hat eine russische Kolonie am Mittelmeer geschaffen. Eine Flottenbasis in Tartus, Syrien, einen Flugplatz bei Latakia, und drumherum ein Land von derzeit wechselnder Form und Grösse, verwaltet von einem Statthalter namens Bashar al-Assad. Während Assad nominell herrscht, schützt die neue, de facto existierende, russische no-fly zone seine Truppen.
Der Satrap verkörpert die einzige anerkannte Regierung Syriens mit Sitz in den Vereinten Nationen, wie praktisch. Er rief Russland zu Hilfe, also ist alles legal. Netterweise helfen auch die Freunde aus Iran mit Fusstruppen, die neue russische Kolonie zu erobern und zu stärken. Man könnte natürlich auch Freiwillige schicken, von denen es im grossen Russland stets ein reichliches Angebot gibt. Es gibt in Syrien praktischerweise zahlreiche Mischehen syrischer Studenten und Militärs, die in Sowjetzeiten im befreundeten Russland ausgebildet wurden und Russinnen heirateten. Ihre Nachkommen eignen sich besonders für den kolonialen Vewaltungsdienst und die Pflege der Völkerfreundschaft.
Das Modell einer Kolonie mit einem grausamen aber loyalen Statthalter hat sich für Putin mehrfach bewährt. Ramzan Kadyrov ist wie Assad Diktator in zweiter Generation und regiert erfolgreich das unruhige, von Islamismus geprägte Tschetschenien. Ähnliche Strukturen finden sich in mehreren zentralasiatischen Staaten der ehemaligen Sowjetunion. Ein einheimischer Diktator unter dem Schutz russischer Waffen: das verspricht jahrzehntelange Stabilität.
Putin braucht für seine Kolonie nicht viel Land. Nur einen breiten Streifen entlang der Küste von Damaskus bis Aleppo, einschliesslich Homs und Hama. Also das Stammland der Assads. Die weiten Gebiete Richtung Irak und Syrisch-Kurdistan braucht er nicht. Dort kann der IS wüten und sich mit den Kurden schlagen. Putins anvisierte Zone westlich Damaskus-Aleppo ist hingegen sehr nützlich, denn sie liegt wie ein Riegel vor dem Mittelmeer. Wer sie kontrolliert, kann beispielsweise verhindern, dass Öl- oder Erdgas-Pipelines aus Qatar oder dem Irak Richtung Europa gebaut werden. Vor allem das billige Gas aus Qatar bedroht Russlands profitables Quasi-Exportmonopol nach Westeuropa.
Warum hilft Teheran?
Ayatollah Chamenei hat gute Gründe, den Russen bei der Gründung ihrer Kolonie in der Levante zu helfen. Auf Gedeih und Verderb ist Teheran mit Assad verbunden. Vielleicht hegen Assad und seine Alawiten viel weniger pro-schiitische Gefühle, als im Westen gerne unterstellt wird. Vielleicht verstehen sich die Alawiten garnicht als Schiiten; niemand weiss das genau. Aber Assad ist als Chef der Baath-Partei ein Laizist und damit automatisch ein Gegner des politischen Islam sunnitischer Machart. Die Alawiten in Syrien und die Aleviten in der Türkei sind Hassobjekte der Sunniten, ebenso wie die Schiiten. Lange Verfolgungsgeschichten schufen Gemeinsamkeiten, die Teheran nun unterstreicht.
Teheran braucht Assad, denn er allein ermöglicht die Existenz einer schiitischen Achse von Iran über den Irak zum Libanon. Ohne Assad wäre die schiitische Hezbollah im Libanon umzingelt von Sunniten und Christen und verlöre ihre jetzige Machtposition. Damit schwände der Traum von einer schiitischen Weltrevolution, beginnend in den Mittelmeerländern.
Teheran hat fraglos erkannt, dass es allein nicht in der Lage ist, Assad auf Dauer vor seinen Feinden zu schützen. Mehrfach in den letzten Monaten schien der militärische Kollaps des Baath-Regimes in Damaskus nahe. Selbst der Beistand der Hisbollah-Kämpfer aus dem Libanon konnte die Terrain-Verluste nicht verhindern. Auch die iranischen Ausbilder, die schiitischen Freiwilligen aus dem Irak und tausende zum Waffendienst in Syrien gezwungene Afghanistan-Flüchtlinge kompensierten nicht den rapiden Verlust der Kampfmoral der Assad-Truppen und die Fahnenflucht. Um das Blatt zu wenden, setzte Teheran seinen besten Mann ein, der sich schon im Irak bewährt hat: General Qassem Soleimani.
Wochenlang pendelte der Chef der freiwilligen Quds-Brigaden zwischen Damaskus, Moskau und Teheran und entwickelte den gemeinsamen Feldzugsplan, der jetzt umgesetzt wird. Mit Putin und Assad offensichtlich vertraut, gilt der von den USA per Kopfgeld gesuchte Soleimani als der spiritus rector des Geschehens.
Soweit sich bisher erkennen lässt, erscheint die Zielrichtung der Verbündeten Russland und Iran klar:
Erste Phase: Einnahme ganz Aleppos und Eliminierung der amerikanisch, saudisch, qatarisch und türkisch geförderten Widerstandsgruppen, einschliesslich al-Nusras, westlich der Linie Damaskus-Aleppo. Aufrechterhaltung einer no-fly zone über dem westlichen Syrien, die ein de facto-Flugverbot für die amerikanisch geführte Koalition und die Türkei über diesem Gebiet bedeutet.
Zweite Phase: Eliminierung der Widerstandsgruppen im Umland und südlich von Damaskus, sowie im Grenzgebiet von Jordanien und dem Libanon.
Ob es nach Erreichung dieser Ziele für Russland und Iran noch sinnvoll ist, den IS im Osten Syriens mehr als symbolisch zu bekämpfen, wird sich zeigen.
Eines hat Putins Sprung nach Syrien gezeigt: indem Moskau mit dem Angebot, den IS zu bombardieren, dem Westen Sand in die Augen streute, konnte die Bastion vor aller Öffentlichkeit aufgebaut werden. Die erfolgreiche Demonstration moderner Rüstung und effektiver Planung zeigt ausserdem, dass die Modernisierung der russischen Streitkräfte durch Putin eine Weltmacht geschaffen hat, die nicht hinter der Potenz der ehemaligen Sowjetunion zurücksteht.
Sowohl Russland als auch Iran haben in den Jahren hoher Erdöleinnahmen viel in ihr Militär investiert. Das Ergebnis der Zusammenarbeit kann man in Syrien beobachten. Es ist durchaus furchterregend.
Ihsan al-Tawil
Update
President Vladimir V. Putin said Russia is currently flying around 50 missions a day on average in Syria.
The aim is to increase this figure to between 200 and 300 a day, according to The Sunday Times.
The construction of a new airstrip is also reportedly under way.
Update II
Wie Le Figaro berichtet, hat sich nach Israel auch Jordanien in aller Stille mit Russland geeinigt, die Kampfmassnahmen im südlichen Syrien abzustimmen. Die gemeinsame Planungsstelle befindet sich in Jordanien.
Kommentar
Präsident Assad hat bereits zurückkehrenden Deserteuren Pardon zugesichert. Angesichts der Tatsache, dass in Syrien hunderte von Milizen kämpfen, deren religiöse oder politische Motivationen oft nur eine Tarnung für kriminelles Verhalten sind, lässt sich erwarten, dass nicht wenige dieser Milizen zu Assads Truppen überlaufen werden, wenn diese besseren Sold, bessere Moral und bessere Ausrüstung vorweisen können. So kann aus den schon voreilig abgeschriebenen Truppen der Regierung schnell wieder ein schlagkräftiges Militär werden.
Update III
Russlands Intervention in Syrien wird scharf von Saudi-Arabien kritisiert, das mehrere islamistische Milizen im Nachbarland unterstützt, durch private Spender wohl auch den IS. Französische Kommentatoren sehen Russlands Vorgehen in Syrien als Teil eines Erdölkrieges mit Saudi-Arabien, das nach dem weitgehenden Verlust seines US-Marktes als Folge von fracking nun aggressiv in Europa und Asien in russische Märkte eindringt. Jüngste Provokation: Saudi-Arabien sandte mehrere Tanker nach Danzig und baut dort Lagerkapazität auf. Mit Discountpreisen dringen die Saudis in Polens traditionell russisch beherrschten Markt ein, der über Pipelines auch Zugang zum deutschen Markt bietet.
In Syrien erzielt Saudi-Arabien mit der Lieferung amerikanischer TOW Anti-Tank-Raketen und kroatischer Mehrfach-Granatwerfer an von der CIA unterstützte Milizen offenbar Erfolge. Die Milizen, einschliesslich der FSA, melden trotz russischer Bombardements Terraingewinne und den Abschuss zahlreicher Panzer der Regierungs-Streitkräfte.
Update IV
Today's Zaman (Turkey) issued this interesting story:
"After weeks of political wrangling, the Iraqi parliament finally agreed to allow Russia to launch air strikes against the terrorist Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) in Iraq, paving the way for the involvement of a powerful new combatant in an already complex battleground in a move that will likely incense the US. Russia now has official permission to strike ISIL in Iraq, following the launch of an air campaign to degrade and defeat the militant group in Syria upon the request of Syrian President Bashar al-Assad."
The story, apparently based on a Reuters news item could be traced back to a report titled "Baghdad Allows Russia to Bomb ISIL Terrorists Running From Syria Into Iraq", carried by the Russian news agency Sputnik which in turn is quoting Fars News Agency (Iran).
Update V
Turkish Prime Minister Ahmet Davutoğlu: "Russia is trying to carry out an ethnic cleansing in northern Latakia to force out all Turkmen and the Sunni population who do not have good relations with the regime. They want to expel them, they want to ethnically cleanse this area so that the regime and Russian bases in Latakia and Tartus are protected," Davutoğlu told members of the international media in İstanbul" (9/12/15)
Update VI
Russlands Machtausübung in Syrien lässt NATO und Israel erschaudern. Modernes Material, hemmungslos eingesetzt, überlegene Elektronik und leistungsfähige Logistik schildert The Independent. (30/1/16)