.... Feds say Russia successfully hacked into the U.S. electrical grid
There are many, many ways to attack a country that don’t involve dropping a single bomb or firing a single bullet. Look around at the political chaos Russia is seeding in the United States at this very moment, having successfully hacked into the Democratic National Committee servers and releasing the information through Wikileaks, using propaganda and social media to deepen social divides on wedge issues like gay marriage and racial equity. All of this paved a path to victory for a president who weakens us every single day he’s in office, degrading our relationships with our most trusted allies and shaking the western alliance to the core.
But another very real danger is lurking, one that could be catastrophic to modern America: an attack on our antiquated electrical grid. Experts warn that our aging grid is a massive threat to our economic and national security. We live in a world powered by this grid. Everything … and I do mean everything. From stoplights to telecommunications to money transactions. Hospitals, schools, gas pumps, water systems. **Poof** All of this could be gone in the flick of a switch.
With that in mind, this news is especially troubling: Department of Homeland Security officials say the Russians successfully hacked into the control rooms of U.S. electrical utilities and could’ve thrown the switches at any time. From the Wall Street Journal:
The Russian hackers, who worked for a shadowy state-sponsored group previously identified as Dragonfly or Energetic Bear, broke into supposedly secure, “air-gapped” or isolated networks owned by utilities with relative ease by first penetrating the networks of key vendors who had trusted relationships with the power companies, said officials at the Department of Homeland Security.
“They got to the point where they could have thrown switches” and disrupted power flows, said Jonathan Homer, chief of industrial-control-system analysis for DHS.
Intelligence experts have been warning of these types of attacks for years.
“They’ve been intruding into our networks and are positioning themselves for a limited or widespread attack,” said Michael Carpenter, former deputy assistant secretary of defense, who now is a senior director at the Penn Biden Center at the University of Pennsylvania. “They are waging a covert war on the West.”
In 2017, Stewart Madnick of the Harvard Business Review wrote about how a loss of power can have a snowball effect on our everyday lives that could be catastrophic.
Here’s an example of second-order effects (though not caused by a cyberattack, they’re a good way to think through what could happen in an attack). In February 2017, an area of Wyoming was hit by a strong wind storm that knocked down many power lines. It took about a week to restore power, due to heavy snow and frozen ground. Initially, water and sewage treatment continued with backup generators. But the pumps that moved sewage from low-lying areas to the treatment plants on higher ground were not designed to have generators, since they could hold several days’ worth of waste. After three days with no power, they started backing up. The water then had to be cut off to prevent backed-up waste water from getting into homes. The area had never lost power for so long, so no one had anticipated such a scenario.
Now think about what would happen if a cyberattack brought down the power grid in New York, for example. New Yorkers could manage for a few hours, maybe a few days, but what would happen if the outage lasted a week or more? For an example of the kind of disruption such an attack could cause, consider the 2011 Japanese tsunami. It knocked out both the power lines and the backup generators at the same time. Either event could have been managed, but both occurring at the same time was a disaster. Without power, the cooling systems in three nuclear reactors failed, resulting in massive radiation exposure and concerns about the safety of food and water. The lesson: We need to prepare not only for an unexpected event but also for the possible secondary effects.
How long could you and your family last without power in the modern world? How many businesses could survive with days, weeks, months of being closed? Russia wouldn’t need to invade the United States to wreak havoc and seriously damage the economy.
It is time to build a wall, America—a cyberwall to protect our nation’s power grid. Forget the concrete and steel monstrosity dividing the U.S. from Mexico, the real enemy, the real threat to America is lurking online. It’s been a matter of economic and national security for years, but now the threat is truly at our door.
See the 2013 Wall Street Journal video below on just how dangerously outdated and vulnerable our grid really is and recall that President Obama offered an infrastructure plan that would’ve upgraded it and safeguarded the nation against attack, but Republicans refused to pass a single package for fear it would make Obama even more popular. It would’ve put a lot of Americans to work and they couldn’t have that, now could they? Nevertheless, in 2009, President Obama awarded a $3.4 billion grant to upgrade the system, but that was really a drop in the bucket compared to the estimated $5 trillion it would take to seriously bring the grid up to modern standards. In fact, one of President Obama’s last acts was to issue orders to prepare options for an attack on the Russian electric grid in response to Russian manipulation of the U.S. presidential election.
Republicans in Congress can no longer put their heads in the sand and ignore the danger lurking at our digital door.
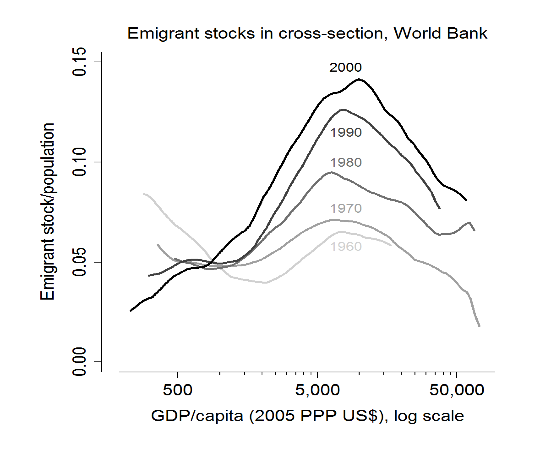

Ägypten: ein Beispiel
Nach dem Zweiten Weltkrieg begann Ägyptens Bevölkerung, schnell zu wachsen mit Raten über 2 Prozent pro Jahr. Der Höchststand von 2,9 Prozent jährlicher Zunahme wurde 1979 erreicht. Auf ein paar schwächere Jahre folgten erneut Wachstumsschübe, die 2012 bis 2014 bei über 2,5 Prozent lagen. Im Jahr 2017 wurde der Zuwachs auf 2,1 Prozent geschätzt. In all den Jahrzehnten hat sich die Gesamtzahl der Kinder pro Frau zwar von 5,3 (1980) auf 3,2 (2003) vermindert. Bis 2014 stieg diese Ziffer aber erneut auf 3,5 an, um 2017 wieder auf 3,1 zu fallen.
Was soll diese Zahlenfolge aussagen?
Dass sich seit Jahrhundertbeginn das Bevölkerungswachstum Ägyptens bei rund 2,2 Prozent Zuwachs pro Jahr mit einer Gesamtkinderzahl pro Frau von 3,2 stabilisiert hat. Mit anderen Worten: Egal, was passiert, egal welche Geburtenkontroll-Propaganda die Regierung betreibt: die Ägypter vermehren sich unverändert schnell. Von 20 Millionen 1949 auf rund 100 Millionen heute, die auf einer landwirtschaftlich nutzbaren Fläche von der Grösse Baden-Württembergs leben und ein Pro-Kopf-Einkommen auf indischem Niveau erwirtschaften, wobei geschätzt ein Drittel der Ägypter unter der Armutsgrenze lebt.
Die rettende Banane
Als es in den 1960er Jahren erste Hungerprobleme gab, konnte Präsident Gamal Abdel Nasser noch behaupten: “Es gibt keinen Hunger in Ägypten. Wenn jemand hungrig ist, geht er einfach in den Garten und pflückt eine Banane.” Für die Armen gibt es heute keine Gärten mehr und keine Bananen. Da seit Nassers Zeiten die Regierungen einen Grossteil ihres Budgets für Brotsubventionen ausgeben, wird der Bevölkerung eine Nahrungsversorgung suggeriert, die das Land stets am Rande des Ruins stolpern lässt. In der Zange zwischen der Drohung von Staatspleite und Brotaufständen ist keine Regierung in der Lage, genug Mittel für langfristige Entwicklung und Investitionen abzuzweigen. Man rettet sich von Tag zu Tag und hofft, dass es trotz aller Misere irgendwie weitergehen wird. Seit Nassers Tagen steckt Ägypten in der Misere und allen Unkenrufen zum Trotz ist es ja weiter gegangen mit mehr Menschen, mehr Armut, mehr Hoffnungslosigkeit.
Den Traum der Demografen beerdigen
Jahrzehntelang hat man sich eingeredet, das Bevölkerungswachstum, das das Land und seine Regierungen überfordert, werde irgendwann zurückgehen. Nun aber ist es Zeit, den Traum der Demografen zu beerdigen: in Ägypten – und anderen Ländern – ist inzwischen das Wachstum der Bevölkerung chronisch geworden. Wieder aktuell wirkt die so viel kritisierte These des schottischen Landpfarrers Thomas Robert Malthus von 1789, dass die Menschheit sich so lange hemmungslos vermehren werde, bis ihr der Hunger Schranken weist.
Ägypten ist seit Jahrzehnten der grösste Weizenimporteur der Welt. Dennoch halten die Brotsubventionen den Hunger nur mühsam im Schach. Schon vor der Jahrhundertwende endete der jahrzehntelange Trend des Rückgangs der Sterblichkeit. Seit 1996 stagniert die rohe Sterberate zwischen 5,6 und 6,5 Prozent trotz des medizinischen Fortschritts. Nicht nur Hunger im Gefolge der rapiden Bevölkerungszunahme kann als Ursache der hohen Mortalität angesehen werden: auch die extreme Belastung der natürlichen Ressourcen wirkt sich auf die Gesundheit des Volkes aus. Es gibt kaum mehr einwandfreies Trinkwasser im Lande. Der Nil als fast alleinige Wasserquelle ist zunehmend verseucht durch Fäkalien und landwirtschaftliche Abwässer. Kairo, um 1955 noch eine nette 3-Millionen-Stadt, ist auf 25 Millionen angewachsen, doch die Infrastruktur hielt nicht Schritt. Das Ergebnis ist eine Verseuchung, die allein nach offizieller Schätzung 2 Prozent aller Todesfälle verursacht. Zu den “positive checks”, die laut Malthus der Bevölkerungsgrösse Grenzen ziehen, gehört ausser Hunger und Mangelernährung offenbar die Verseuchung der Umwelt.
Ägypten steht mit seiner demografischen Problematik nicht allein. Andere Länder im Nahen Osten und Afrika zeigen ähnliche Tendenzen. Notwendig erscheint jetzt, die offiziellen Bevölkerungsprognosen der Vereinten Nationen, der Weltbank und des U.S. Census Bureau nachzurechnen unter der neuen Annahme, dass es Länder gibt, in denen das Wachstum nicht sinken wird, wie es in Lateinamerika und weiten Teilen Asiens tat und noch tut.
Damit sind die beruhigenden Prognosen, die für das Jahr 2100 ein Maximum von rund 11 Milliarden Erdbewohner erwarten, fragwürdig geworden. Wie viele werden es sein, wenn es Länder gibt, in denen das Wachstum chronisch geworden ist? Die immer und unablässig ihr Malthus’sches Maximum anstreben? Wenn es gelingt, die durch die Malthus’schen Checks drohenden Katastrophen einigermassen zu vermeiden, so kann sich die Bevölkerung bei etwas über 2 Prozent jährlicher Zunahme alle dreissig Jahre verdoppeln. Noch vor der Jahrhundertmitte würde Ägypten 200 Millionen Einwohner zählen, und 400 Millionen um 2080. Unvorstellbar?
Ein anderes Beispiel: Äthiopien
Ein anderes 100-Millionen-Land ist Äthiopien. Dessen alten Kaiser Haile Selassie erlebte ich in den 1960ern, als sein Reich damals etwa 22 Millionen Einwohner zählte, und in dem jedes Jahr irgendwo Hungersnot herrschte. Damals war Äthiopien ein Land besonderer Art, das von der Ausfuhr von Kaffee, Häuten und den Remittenten in Gold der Prostituierten lebte, die in Arabien arbeiteten. Seit 1960 bewegt sich die Bevölkerungs-Zuwachsrate stetig zwischen 2,5 und 3 Prozent pro Jahr, ohne dass eine Tendenz zum Rückgang zu erkennen wäre. Im Gegenteil: Für das Jahrfünft 2010 bis 2015 schätzt man die Zuwachsrate auf einen neuen Hochstand von 2,7 bis 2,85 Prozent. Hält das Wachstum an, dann wird in 23 -26 Jahren, also um 2040, die nächste Verdoppelung auf 200 Millionen erreicht sein. Die muslimische Hälfte der Bevölkerung wächst schneller als die christliche: die ethnischen Somali-Frauen halten den Rekord mit durchschnittlich 7,1 Kindern.
Wie bekannt, stösst das klassische Land der Hungersnöte immer wieder gegen seine Malthus'schen Grenzen, ohne dass das Wachstum der Bevölkerung dadurch wesentlich gebremst worden wäre. Weder die Entwicklung der Sterbeziffern noch die der rohen Sterblichkeitsrate lassen den Einfluss der Hungersnöte erkennen. Freilich muss man beachten, dass die Ziffern allesamt Schätzungen darstellen, denn eine genaue Bevölkerungsstatistik gibt es nicht.
Unvorstellbares Wachstum
Hätte man mir, als ich 1955 in Kairo lebte, gesagt, dass das Land einmal 100 Millionen ernähren und kleiden werde, so hätte ich das als Utopie verlacht.
Alle Prognosen des weltweiten Ressourcenverbrauchs, der Umwelt und des Klimawandels gehen von der Grundannahme einer sich langfristig stabilisierenden Weltbevölkerung aus. Wenn die Bevölkerung vor allem im Nahen Osten und in Afrika aber immer weiter wächst, ohne dass ein Maximum in Sicht wäre? Weil der medizinische Fortschritt um die Mitte des 20. Jahrhunderts ein Malthus’sches Gleichgewicht zerstört und damit ein Wachstum entfesselt hat, das von selbst nicht mehr zum Stillstand kommt?
Ist die Welt deshalb zum Wachstum verurteilt?
Heinrich von Loesch
...wurde mir im August 1944 die Ehre zuteil, ein paar Wochen im Gauschulungsheim Nussdorf am Attersee paramilitärisch ausgebildet zu werden und mich dadurch für Aufnahme in eine NAPOLA-Erziehungsanstalt zu qualifizieren (die mir gottseidank erspart blieb). Warum ich mich gerade jetzt an diese ungewöhnlichen Sommerferien erinnere?
Weil ich einen Bericht über die Casa Padre sah, einen ehemaligen WALMART im südlichen Texas, der zum Lager für fast 1500 den Eltern weggenommenen oder unbegleitet illegal eingewanderten Jungen umfunktioniert wurde. Ein Lager wie in Nussdorf, nur moderner und komfortabler. Einzelbetten statt Doppel-Stockbetten, ein Friseursalon, besseres Essen, fraglos. Fast alles auf spanisch, gelegentlich ein Hinweis auf englisch.
Die Kinder? Ernste Gesichter, so wie wir damals in der Routine des Lagerlebens: sechs Uhr morgens aufstehen, Betten bauen und mit DDT-Pulver desinfizieren. Frühsport – laufen. Danach Blümchenkaffee. Turnen: Liegestütze, Kniebeugen mit-Karabiner auf den ausgestreckten Armen. Wehrunterricht: Ballistik. Nachmittags: Kleinkaliber-Schiessen, Panzerfaust-Ausbildung. Undsoweiter.
Ich war zehn Jahre alt und litt an Heuschnupfen, den niemand erkannte – weder die Eltern, noch gar die Lagerleitung. Ich hatte mir die Wimpern abgeschnitten, weil ich sonst morgens die verklebten Augen nicht hätte öffnen können. Ich war nicht traurig, denn ich wusste, dass ich am Ende des Lehrgangs wieder nachhause konnte. Wo die Tiefflieger Jagd auf Schulkinder machten. Aber zuhause.
Nicht so die Jungen in der Casa Padre: für viele von ihnen gibt es keine oder nur unerreichbare Eltern. Ihre Zukunft ist ein riesiges Fragezeichen. Werden Sie englisch lernen dürfen, müssen? Werden sie, sobald sie erwachsen sind, abgeschoben in ein Land, das sie nicht kennen, oder sollen sie anonyme Amerikaner werden, ohne Familie, ohne Geschichte, vielleicht sogar ohne richtigen Namen?
Die Casa Padre, ihre erste Heimat in den USA, die sie Disziplin und Benehmen lehrt: Sauber, ordentlich, relativ komfortabel. Irgendwann wird sie abgerissen werden, vergessen sein, eine peinliche Erinnerung für künftige Regierungen, so wie das Gauschulungsheim, von dem in Nussdorf keine Spur mehr zu finden ist, kein Hinweis auf Wikipedia, nichts, was die fröhliche Bade-und Touristik-Idylle am Attersee stören könnte.
Heinrich von Loesch
Migrant children in U.S. government custody, it turns out, are housed in very comfortable facilities with better food, housing, medical care and education services than many American children in low-income families receive.
